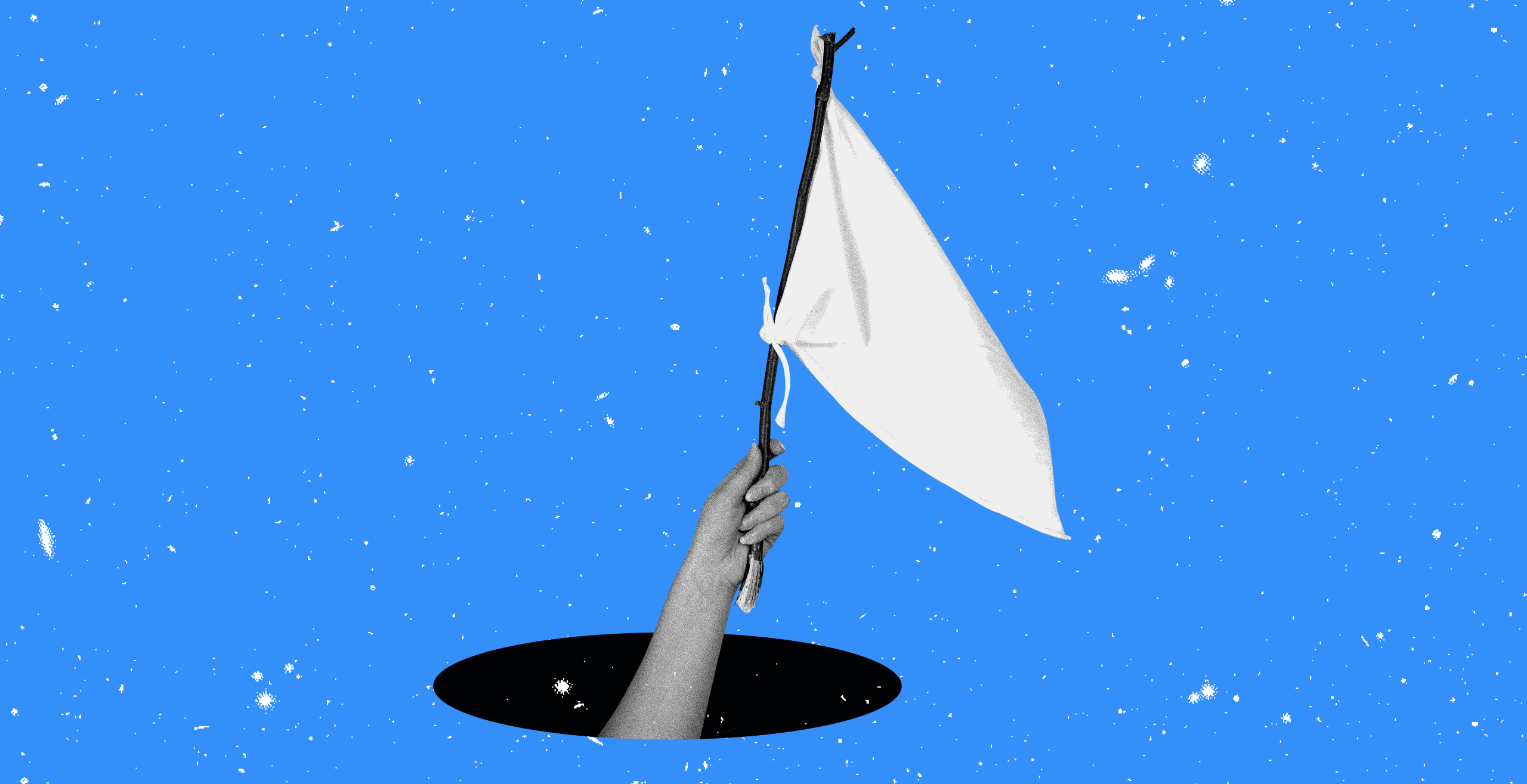Mit dem Wissen von heute, glaube ich das nicht. Damals aber habe ich vielleicht nicht ausreichend darauf geachtet. Natürlich: Ohne Freiheit ist alles nichts, aber das heißt nicht, dass der Umkehrschluss auch richtig wäre. Es ist vielmehr so, dass es Bedingungen braucht, damit Freiheit gelebt werden kann. Westernhagen singt: „Der Mensch ist leider nicht naiv / Der Mensch ist leider primitiv / Freiheit, Freiheit / Wurde wieder abbestellt“.
Freiheit ist Voraussetzung und Folge ihrer eigenen Bedingungen. Sie kann ihre eigenen Grundlagen aber nicht garantieren, sondern muss sie anderweitig suchen. Sie braucht Verantwortung für das eigene Handeln und Respekt vor den anderen. Das macht die Angelegenheit notgedrungen kompliziert. Deshalb ist die Beschäftigung mit der Freiheit aber auch ein so spannendes Projekt. Allerdings auch eines, bei dem wir alle miteinander momentan nicht gerade die beste Figur machen. Freiheit scheint zur prekären Ressource zu werden. Die Gegenwart und ihre Probleme scheinen so kompliziert geworden zu sein, dass sich immer weniger Menschen zutrauen, sie zu verändern. Stattdessen werden Bedenken geäußert, Sachzwänge angeführt, vergebliche Versuche der Vergangenheit geschildert. Das kann man sogar messen: In der vorletzten PISA-Studie wurden fünfzehnjährige Schülerinnen und Schüler gefragt, ob sie der Aussage zustimmen, dass sie etwas gegen die Probleme der Welt tun können. Im Schnitt haben 60 Prozent der Befragten in den OECD-Ländern dem zugestimmt. In Portugal waren es mehr als 74 Prozent, in Taiwan sogar über 80 Prozent. Und in Deutschland? So wenig Jugendliche wie nirgendwo sonst: Gerade 40,9 Prozent glauben, dass sie etwas tun können, das die Probleme der Welt lindert.
Aktuell besteht Anlass zu der Hoffnung, dass es gelingt, aus dieser sozialen Resignation herauszukommen. Der demokratische Aufstand der Anständigen seit Jahresbeginn macht Mut. Hunderttausende wenden sich endlich gegen eine Politik, die Deutschland in die fünfziger oder gar dreißiger Jahre zurückführen will. Und zwar nicht nur in den großen Metropolen, sondern überall im Land. Aber es wird nicht reichen, bloß nein zu sagen und damit implizit den Status Quo zu bekräftigen. Solange nur diejenigen als eine Alternative erscheinen, die zurück in die Vergangenheit wollen, fehlt etwas Entscheidendes. Eine Idee, wie es gut nach vorne gehen könnte. Durch die ganzen Schwierigkeiten hindurch. In die Zukunft gehen. Diese Idee lässt sich nur aus der gesellschaftlichen Mitte heraus entwickeln. Denn so wie schon 1989 geht es wieder um etwas. Und zwar um etwas Grundsätzliches. Um die Demokratie.
Aktuell erscheinen Bücher, in denen über ihren Tod nachgedacht wird. Es heißt plötzlich, dass die moderne Demokratie vielleicht auch nur eine Episode in der Menschheitsgeschichte sei. Und dass die autokratischen Systeme das mitbrächten, was es für die aktuellen Wandlungsprozesse bräuchte. Es scheint so, als müssten wir die Zukunft der Demokratie wieder einmal erringen. Diesmal in West und Ost gemeinsam. Und dieser Kampf um die Demokratie ist eben auch ein Kampf darum, wie die flüchtigen Wahrheiten des Miteinanders entstehen. Dass genau das schwieriger wird, ist einer der zentralen Gründe für die Schwierigkeiten, in die eine offene, vielfältige, demokratische und freie Gesellschaft zunehmend gerät.
Vor ein paar Jahren hat die ehemalige Literaturkritikerin der New York Times Michiko Kakutani ein schmales Büchlein geschrieben, das den Titel Der Tod der Wahrheit trug. Es ist eine Streitschrift gegen den sehr speziellen Umgang mit der Wahrheit, den der damalige und vielleicht zukünftige US-Präsident Donald Trump pflegt. Und es hat eine sehr besondere Pointe: Kakutani zufolge schlagen Populisten wie Trump die Aufklärung mit ihren eigenen Mitteln. Denn wenn nichts mehr feststeht, dann lässt sich unwidersprochen alles behaupten. Und zwar in solch unüberschaubarer Fülle, dass niemand mehr weiß, wem oder was man jetzt eigentlich noch glauben soll.
Die Freiheit ist nicht dagegen gefeit, von ihren Feinden gegen sich selbst genutzt zu werden. Kakutani macht den Beginn dieser Entwicklung in den Ideen der Postmoderne aus. Diese hatten zunächst befreiende Wirkung, weil sie die letzten ehemals ehernen, vermeintlich objektiven und in Stein gemeißelten Wahrheitsansprüche verflüssigt haben. Und das zu einer Zeit, als andernorts die Wahrheiten noch als endgültig erkannt schienen, weil sie durch die Geschichtsphilosophie des historischen Materialismus nun einmal nur so und nicht anders denkbar waren. Die postmodernen Denkerinnen und Denker hingegen betonen, dass es unterschiedliche Erzählungen, unterschiedliche Perspektiven und unterschiedliche Biografien gibt, die zu unterschiedlichen Zugriffen auf Wirklichkeit führen können.
Es ist zunächst ein emanzipatorischer Fortschritt, dass individuelle Perspektiven und ihre Geschichte als relevant anerkannt werden. Aber in dem Moment, in dem diese relativierende Vielfalt politisch strategisch genutzt wird und sich überdies mit Narzissmus und Beliebigkeit verbindet, wird es gefährlich. Dann hat zwar jeder und jede Einzelne einen eigenen Zugriff auf die Wirklichkeit, aber es fehlt die gemeinsame Kraft, diese Vielfalt unterschiedlicher Perspektiven so zueinander in Beziehung zu setzen, dass unsere Gesellschaft erkenntnis- und handlungsfähig bleibt. Eine aufklärerische Praxis verkehrt sich dann in ihr Gegenteil, wenn sie – im Moment ihrer potenziell vollständigen Verwirklichung – in die falschen Hände gerät und strategisch instrumentalisiert wird. Dann kommen Leute wie der ehemalige Trump-Berater Steve Bannon auf den Platz, die eine neue strategische Losung ausgeben: „Let’s flood the zone with shit“ – lasst uns die Zahl der möglichen Sichtweisen so sehr erhöhen, dass keiner mehr irgendwas sieht oder gar glaubt!
Die Freiheit der individuellen Behauptung ist schließlich durch die digitalen Möglichkeiten ins Unermessliche gestiegen. Und es gelingt immer seltener, aus dieser wahrnehmbaren Vielheit der individuellen Stimmen die Vernunft einer modernen Gesellschaft herauszuhören oder zu destillieren. Das hat zur Folge, dass die unterschiedlichen Konstruktionen der Wirklichkeit nur noch ratlos, gleichgültig oder aggressiv nebeneinander vertreten werden. Und die Chance steigt, dass sich bloß noch die lauteste und vehementeste Behauptung durchsetzt, wenn in der Flut der Äußerungen das vernünftige Gespräch nicht mehr organisierbar ist. In dem Song Alle reden durcheinander singt der Liedermacher Danny Dziuk: „Grabenkämpfe / und du weißt nicht wie / Doch plötzlich findest du dich sonderbar / Verwundert auf ‘ner Seite wieder, die / Niemals deine eigene war / Wo jeder schreit ‚Auf welcher Seite stehst du?’ / Und alle reden durcheinander / Und keiner hört zu”.
Die Schilderung klingt vertraut. Jeder steht gerne auf der richtigen Seite. Nur leider wissen die meisten derzeit oft nicht, welche Seite das ist. Und das scheint viele zu nerven. Wer auf andere Meinungen stößt, die nicht gefallen, die aufregen und zum Widerspruch anstacheln, reagiert zunehmend weniger damit, dass er sich interessiert, dass er widerspricht und dass er sich in der Sache auseinandersetzt. Und natürlich hört kaum jemand überhaupt zu, was geantwortet wird, wenn eine Position hinterfragt wird. Sondern alle fangen beinahe sofort an, sich zu empören. Dann geht es um Meinungsfreiheit oder verletzte Gefühle. „Das wird man doch wohl noch sagen dürfen“ versus „Macht mal Platz, ihr alten weißen Männer.“ Dieses Durcheinander hilft jenen, die das Chaos wollen, um sich dann als neuerlich ordnende Kraft zu inszenieren. Das Muster ist fast immer dasselbe: Zunächst werden zu viele Regeln beklagt, die die eigene Freiheit über Gebühr einzuschränken scheinen. Gesellschaft und Staat sind schuld daran, dass man nicht frei leben könne. „Die da oben“ müssen weg.
Die dahinterliegende Denkfigur ist recht schlicht und an einem Beispiel zu erklären, das mir ein Freund vor einiger Zeit erzählte. Es ging um eine Begegnung, die er in den USA mit einem Professor hatte. Der erklärte ihm, warum die USA auf dem Weg in die Diktatur seien: Er zeichnete eine Linie auf ein Blatt Papier, zeigte auf das eine Ende und sagte: „Dort ist Freiheit, das heißt: keine Gesetze. In den letzten zweihundert Jahren gab es immer mehr Politiker, die immer mehr Gesetze erlassen haben.“ Dann zeigte er auf das andere Ende der Linie und meinte: „Alles ist gesetzlich geregelt, das ist Diktatur. Und wir sind definitiv eher an diesem Ende als am anderen.“
Diese Art des Denkens ist inzwischen auch in der Bundesrepublik angekommen, wenn man sich anschaut, was auch hier alles als Einschränkung der Freiheit betrachtet wird: das Tragen einer Maske während der Pandemie, ein Tempolimit auf Autobahnen, ein vegetarischer Tag in der Kantine, die Pflicht zur Steuererklärung, der Appell zu einem maßvollen Ressourcenverbrauch und nicht zuletzt die Achtung vor Anderen beim Sprechen und Formulieren. Allzeit empörungsbereit werden Vorschläge für gemeinsame Regeln eines solidarischen Umgangs kategorisch abgelehnt und vor allem auf digitalen Plattformen wüst diffamiert. Die Folge ist eine merkwürdige Mischung von übersteigerten Freiheitsansprüchen einerseits und dem Wunsch, selbst für Klarheit und Ordnung sorgen zu können, andererseits. Der Soziologe Oliver Nachtwey und die Literatursoziologin Carolin Amlinger nennen das „libertären Autoritarismus“. Bei Querdenker-Demos, bei Protesten gegen die Migrationspolitik oder im Diskurs über vermeintliche Grenzen des Sagbaren wird von immer mehr Menschen der moderne Gesellschaftsvertrag quasi aufgekündigt, um zu einem Naturzustand absoluter individueller Freiheit zurückzukehren.